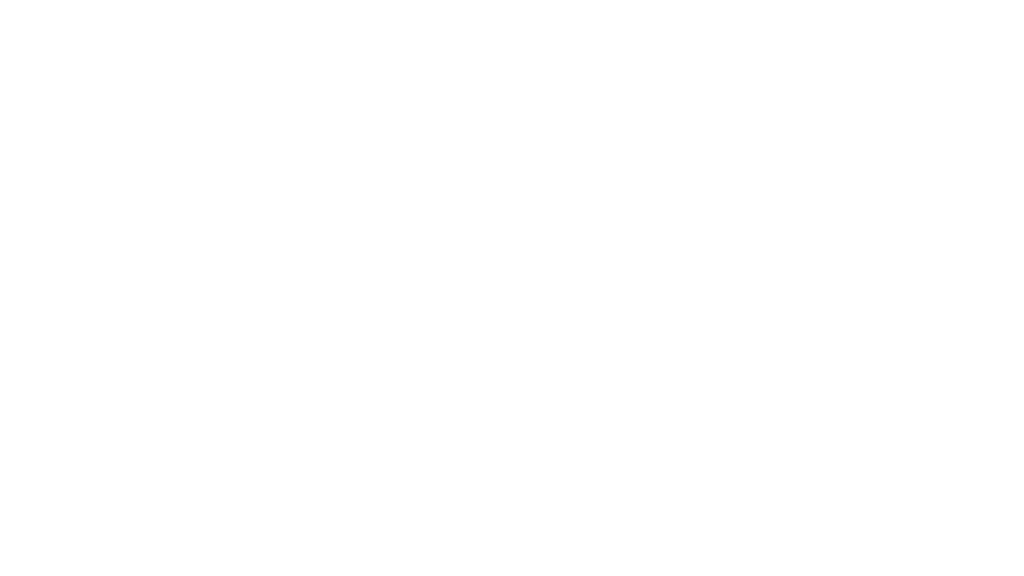Mit ihrer hohen Verfügbarkeit und Beständigkeit trägt Wasserkraft dazu bei, die volatile Erzeugung aus Windenergie und Photovoltaik auszugleichen. Damit ist sie ein zentraler Baustein für das Gelingen der Energiewende.
Energie aus Wasserkraft
Energie aus Wasserkraft
Wasser - die zentrale Kraft für die Energiewende
Erneuerbare Energie aus Wasserkraft ist ein zentraler Baustein für das Gelingen der Energiewende und die Unabhängigkeit von fossilen Energieträgern wie Erdöl und Erdgas. Durch ihre hohe Verfügbarkeit und Beständigkeit gleicht sie die veränderliche Erzeugung aus Wind- und Sonnenenergie aus und erhöht so die Netzstabilität. Mit 100 Wasserkraftwerken und dem Erfahrungsschatz aus über einem Jahrhundert Erzeugung von Energie aus erneuerbaren Quellen leistet die Kelag so einen maßgeblichen Beitrag zu einer grünen und lebenswerten Zukunft.
Der Garant für Stabilität
In jedem Moment muss die Menge Strom erzeugt werden, die verbraucht wird. Laufwasserkraftwerke tragen hier zur Deckung der Grundlast bei, denn sie erzeugen konstant Strom. Sie stellen die Balance zwischen Windkraft, die vor allem im Winter zur Verfügung steht, und Sonnenenergie mit einem Erzeugungsschwerpunkt in den Sommermonaten sicher. Um die erneuerbaren Energieträger Wasser, Wind und Sonne zu jeder Zeit optimal nutzen zu können, engagiert sich die Kelag für einen ausgewogenen Ausbau von Wasserkraft, Photovoltaik und Windkraft in Österreich und darüber hinaus.
Die grüne Batterie
Die Speicherkraftwerke der Kelag erzeugen Strom auf Knopfdruck — und zwar immer dann, wenn er dringend gebraucht wird. Pumpspeicherkraftwerke nehmen große Energiemengen wahlweise auf oder geben sie zur Stromerzeugung ab. So werden Schwankungen ausgeglichen, die bei der Erzeugung von Strom aus den erneuerbaren Energiequellen Wind und Sonne oder bei starken Lastwechseln entstehen. Diese effiziente Leistung und die nachhaltige Nutzung erneuerbarer heimischer Energie aus Wasserkraft machen Pumpspeicherkraftwerke zu grünen Batterien, die wesentlich dazu beitragen, die Klimaschutzziele zu erreichen.
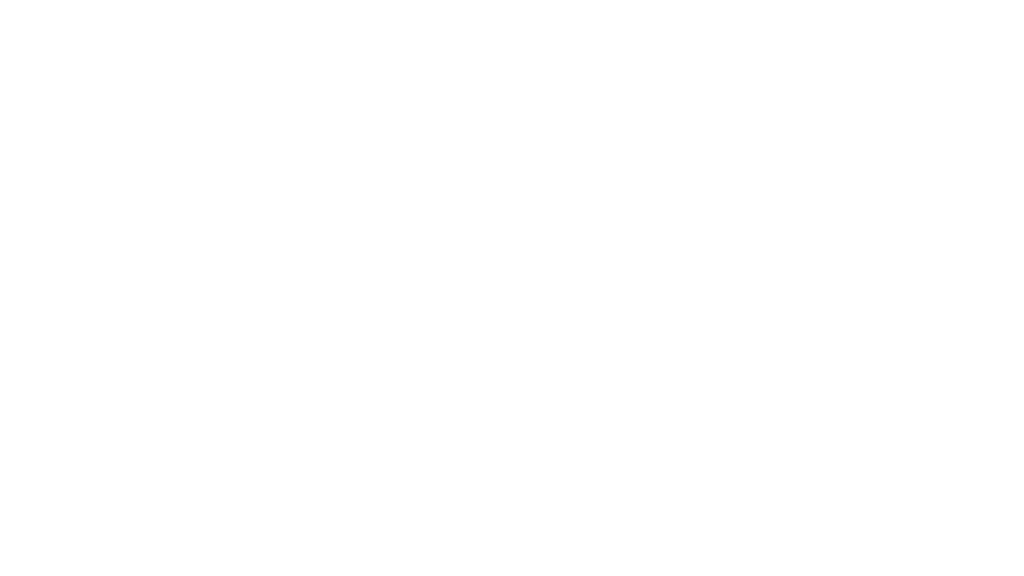
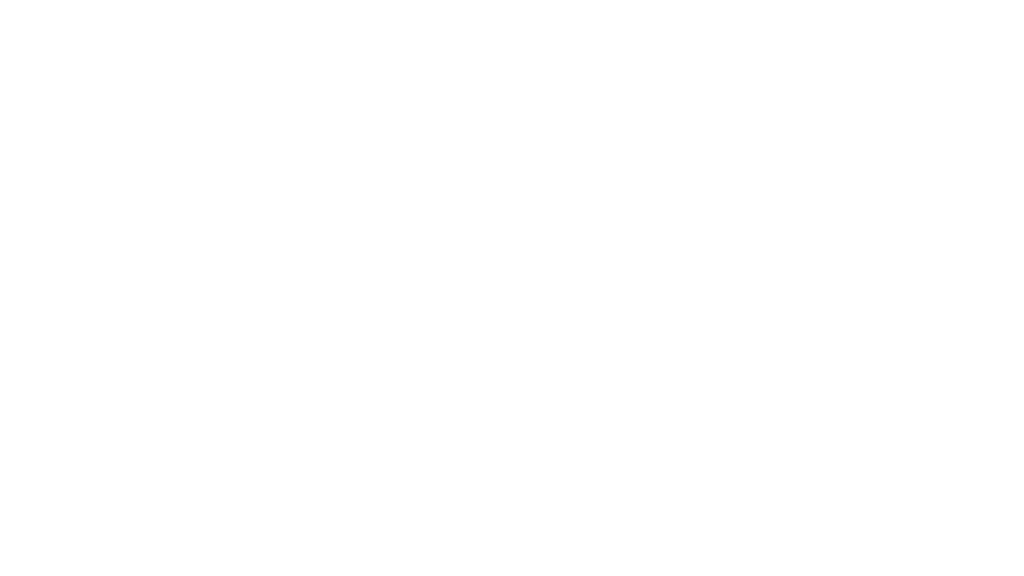
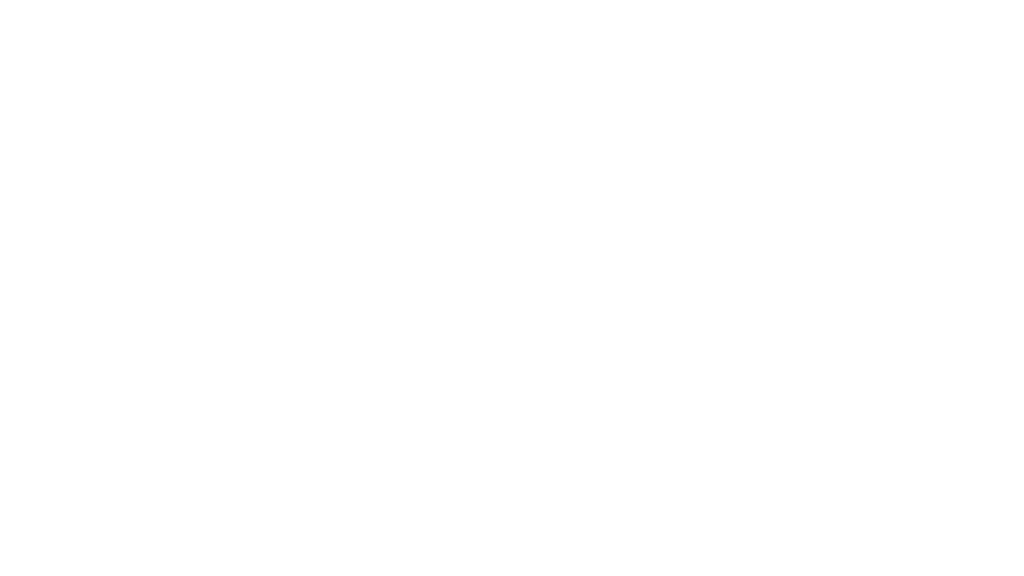
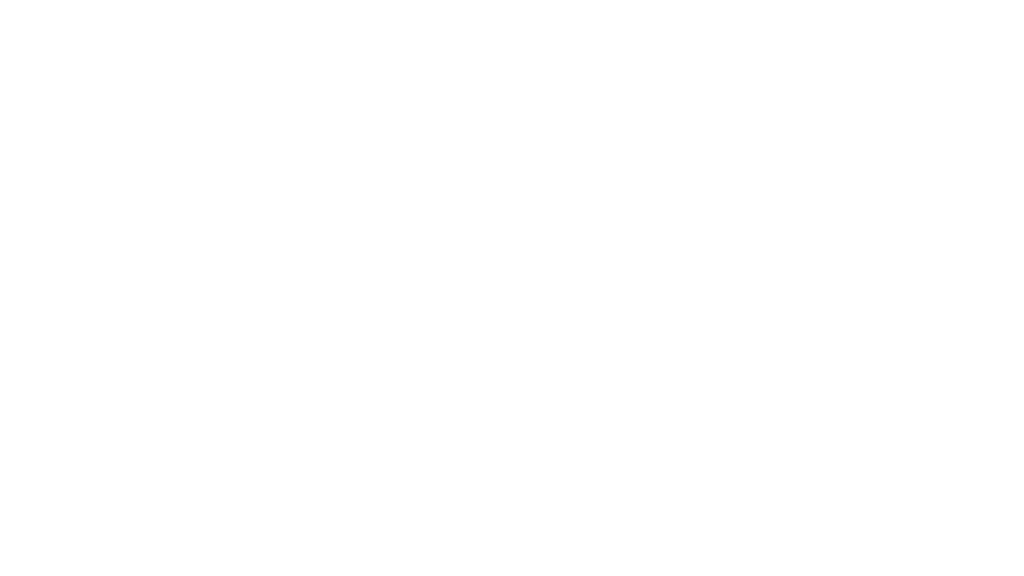
Sichere Versorgung mit sauberer Energie
Die bestens ausgebildeten Mitarbeiter der Kelag stellen mit ihrer Erfahrung seit rund 100 Jahren die verlässliche Versorgung mit elektrischer Energie sicher. Eine besondere Rolle für die Versorgungssicherheit in Kärnten spielt die Kraftwerksgruppe Fragant im Mölltal. Mit ihrem komplexen Zusammenspiel von Speichern, Stollen und Beileitungen ist sie das Herzstück der Stromerzeugung aus Wasserkraft in der Kelag — auch im Fall eines Blackouts.
Was ist ein Störfall, was ist ein Blackout?
Störfälle sind regional begrenzt und werden durch Wetterextreme wie Sturm, Blitzschlag und Nassschneefälle oder technische Faktoren ausgelöst. Von solchen Störfällen können hunderte oder tausende Kunden betroffen sein. Von einem Blackout sprechen wir, wenn großflächig und überregional hunderttausende oder gar Millionen Kundenanlagen nicht mehr mit Strom versorgt werden können, wenn also ganze Länder „finster“ sind.
Was passiert im Fall eines Blackouts?
Sollte es zu einem Blackout in Österreich kommen, ist die Kelag in Kärnten in der Lage, die Stromversorgung aus eigener Kraft wiederaufzubauen. In der Kraftwerksgruppe Fragant verfügt die Kelag über sogenannte schwarzstart- und inselbetriebsfähige Maschinensätze. Sie können im Ernstfall ohne Fremdenergie gestartet werden. Kraftwerke dieser Art sind die Voraussetzung für den Aufbau einer Inselversorgung. Durch das Zuschalten weiterer Kraftwerke und die Inbetriebnahme einzelner Netzgebiete — immer im Gleichgewicht von Erzeugung und Verbrauch — wird schrittweise ganz Kärnten wieder mit Strom versorgt. Unter der Voraussetzung, dass alle technischen Anlagen im Stromnetz funktionsfähig sind, kann die Kelag die Stromversorgung im ganzen Bundesland innerhalb eines Tages Großteils wiederherstellen.
Energie erzeugen — im Einklang mit Mensch und Natur
Bei allen Projekten binden wir Bevölkerung, Behörden und Gemeinden mit ein, um Auswirkungen auf Umwelt und Gesellschaft zu berücksichtigen. Maßnahmen zur Vermeidung, Beseitigung oder Verringerung von Umweltauswirkungen werden in Kooperation mit Experten ermittelt und von umfangreichen ökologischen Monitoringprogrammen begleitet. Damit stellen wir sicher, dass die Wasserkraft sowohl durch ihre systemdienlichen Eigenschaften als auch durch ihren Sekundärnutzen wie den Hochwasserschutz und die touristische Nutzung als Lebens- und Erholungsraum positiv zur Transformation des Energiesystems beiträgt.
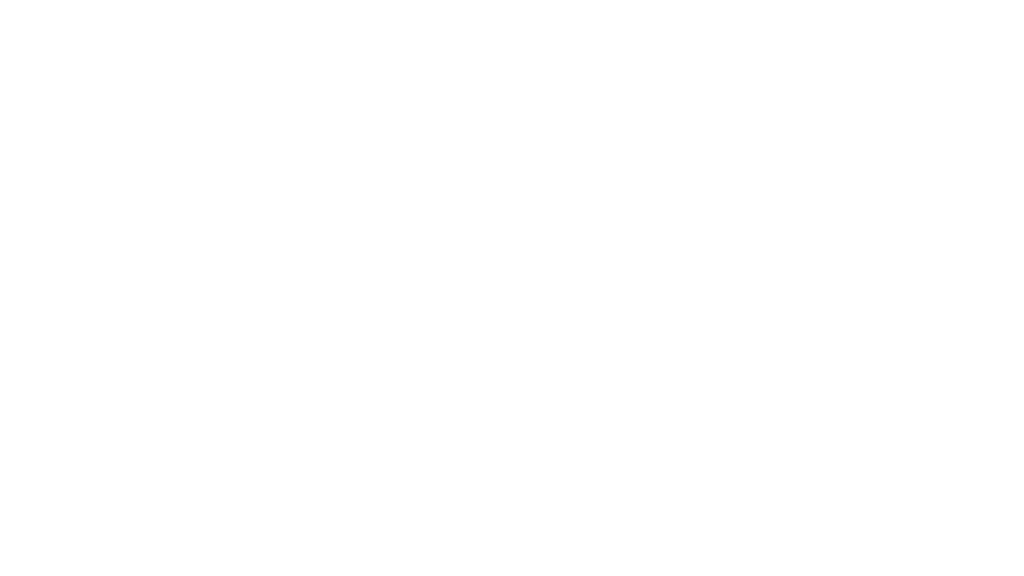
5 Fakten zur Wasserkraft
Neben ihren systemdienlichen Eigenschaften verfügt Wasserkraft über zahlreiche Sekundärnutzen. So tragen Speicherseen einerseits zum Hochwasserschutz bei. Andererseits entstehen durch sie Lebens- und Erholungsräume in der Natur, die vielfach auch touristisch genutzt werden.
Der Anteil der Wasserkraft am erneuerbaren Strom in Österreich beträgt mit rund 42 Terawattstunden bereits rund 78 Prozent. Der Anteil der Wasserkraft in Kärnten betrug im Jahr 2019 rund 83 Prozent.
Wir investieren laufend in die Effizienzsteigerung und Optimierung von bestehenden Anlagen und in die Errichtung von neuen Kraftwerkskapazitäten.
Die Kraftwerksgruppe Fragant im Mölltal leistet durch ihre Schwarzstartfähigkeit im Fall eines Blackouts einen wesentlichen Beitrag zur Versorgungsfähigkeit.
Wir sprechen aus Erfahrung
Im Jahr 1923 begann die Geschichte der Kelag mit der visionären Idee für das Kraftwerk Forstsee, das die Landeshauptstadt Klagenfurt als erstes Speicherkraftwerk Kärntens mit Strom versorgte. Damit war Grundstein für unsere umfassende Erfahrung auf dem Gebiet der Erzeugung und Übertragung von nachhaltig produziertem Strom aus erneuerbaren Quellen gelegt. Gemeinsam mit unseren Tochterunternehmen verfügen wir heute über umfassende Kompetenzen im Umgang mit Energie und sind einer der führenden Energiedienstleister Österreichs.
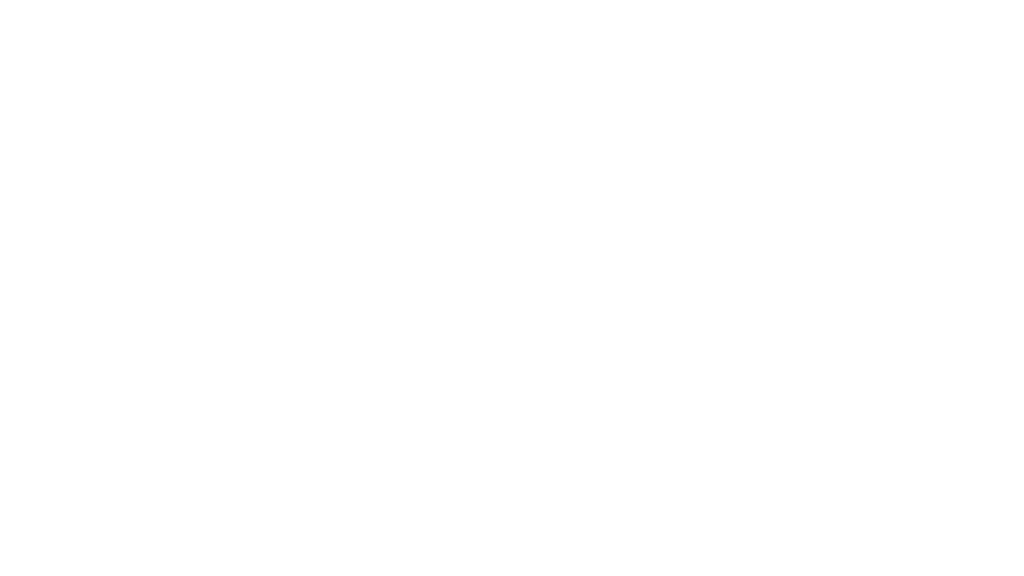
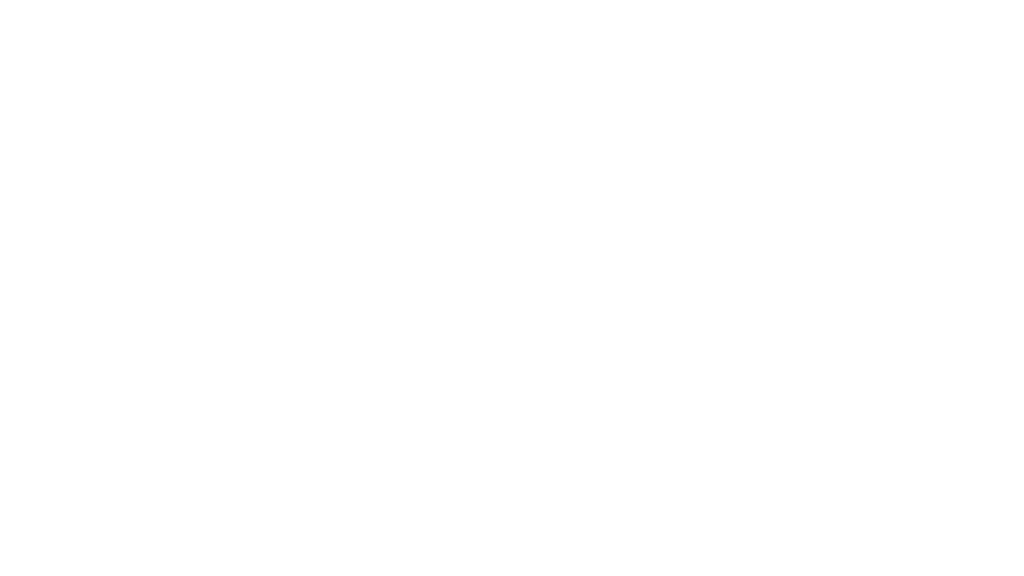
Wir sind international
Wir von der Kelag setzen uns ambitionierte Ziele und verfolgen diese mit Mut und viel Energie. Dazu zählt auch der grenzüberscheitende Einsatz für die Gestaltung einer hoffnungsvollen, grünen Zukunft. Mit unserem Tochterunternehmen Kelag International leisten wir einen Beitrag zum Gelingen der europäischen Energiewende.
Noch kein Kelag-Kunde?
Die Kraftwerksgruppe Fragant
Die Kraftwerksgruppe Fragant im Mölltal ist ein Grundpfeiler für die sichere und zuverlässige Stromversorgung in Kärnten. Die rund 790 Millionen erzeugten Kilowattstunden Strom entsprechen einem Jahresbedarf von rund 225.000 Haushalten. In ihrer Komplexität ist die Kraftwerksgruppe Fragant, die von 1962 bis 1986 errichtet und von 2006 bis 2011 um das Pumpspeicherkraftwerk Feldsee erweitert wurde, einzigartig. Mit einer Vielzahl von Speichern, Stollen, Rohrleitungen und Kraftwerken, verteilt auf unterschiedlichsten Niveauhöhen zwischen 700 und 2.500 Metern Seehöhe, bildet sie das Herzstück der Stromerzeugung der Kelag.
In der Kraftwerksgruppe Fragant wird das Wasser der Hohen Tauern zur Stromerzeugung genutzt. Das europaweit einzigartige System besteht aus sechs großen und mehreren kleinen Hochgebirgsspeichern, sieben Speicher und drei Laufkraftwerken. Über Stollen, Beileitungen und Ausgleichsspeicher wird das Wasser zu den Turbinen in den Krafthäusern geleitet oder in höher gelegene Speicherseen gepumpt. Die Speicher dienen außerdem dem Hochwasserschutz, da sie bei großen Niederschlagsmengen Teile des natürlichen Abflusses zurückhalten können.
Die Speicherkraftwerke in der Kraftwerksgruppe Fragant im Mölltal erzeugen auf Knopfdruck Strom, wenn er dringend benötigt wird. Im Stromnetz muss stets ein Gleichgewicht zwischen Erzeugung und Verbrauch herrschen. Pumpspeicherkraftwerke können große Energiemengen wahlweise aufnehmen oder zur Stromerzeugung abgeben. So werden Schwankungen ausgeglichen, die bei der Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energiequellen oder bei starken Lastwechseln entstehen. Ein ausgewogener Mix erneuerbarer Erzeugungsanlagen auf Basis von Wasser-, Wind- und Sonnenenergie sichert damit eine stabile Energieversorgung.
Diese effiziente Leistung und ihre nachhaltige Nutzung erneuerbarer, heimischer Energie aus Wasserkraft machen Pumpspeicherkraftwerke zu grünen Batterien, die wesentlich dazu beitragen, die ambitionierten Klimaschutzziele zu erreichen.
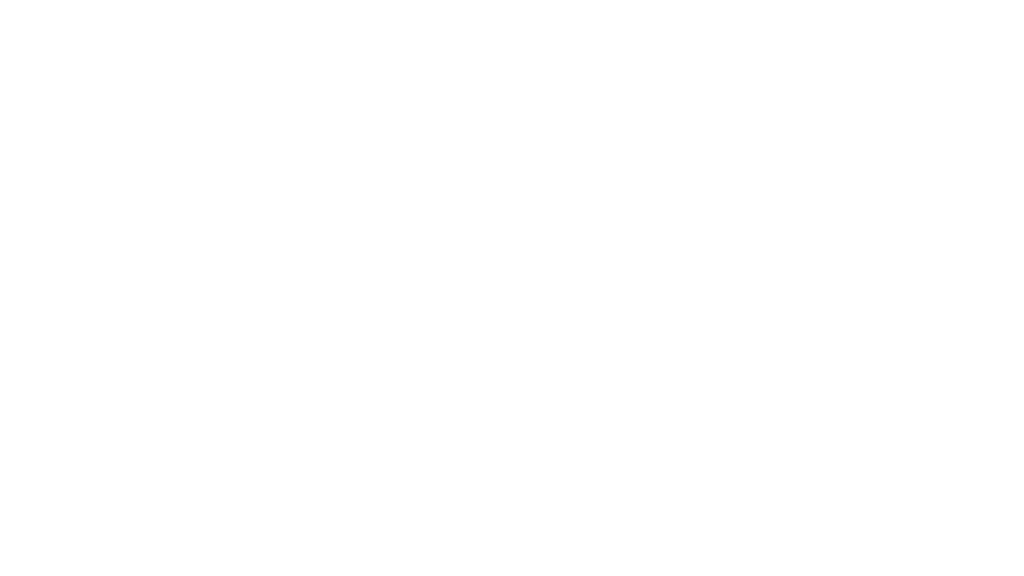
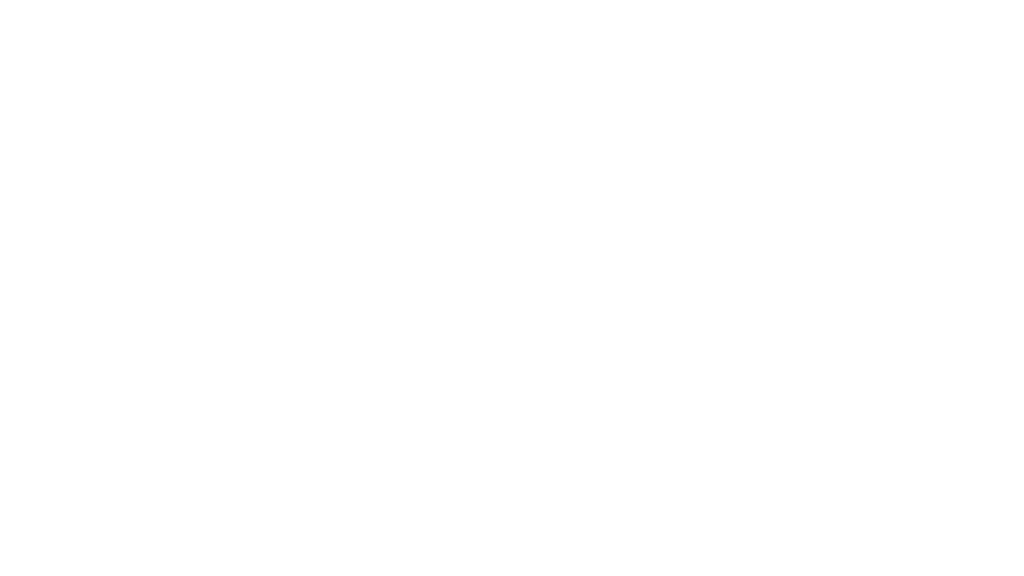
Das Kraftwerk Schütt
Das Kraftwerk Schütt an der Gail ist das größte Laufkraftwerk der Kelag. Es besteht aus den Kraftwerksanlagen Schütt 1 mit einer Leistung von 4,1 Megawatt und Schütt 2 mit einer Leistung von 12,5 Megawatt. In Summe erzeugt das Kraftwerk Schütt jährlich rund 63,5 Millionen Kilowattstunden Strom und versorgt damit mehr als 17.000 Haushalte mit erneuerbarer Energie aus Wasserkraft.
In der Zeit von Juni 2018 bis Juni 2019 wurde das Kraftwerk Schütt umfangreich saniert und erneuert. Um die Effizienz der teilweise über 100 Jahre alten Anlage zu steigern, wurde der Oberwasserkanal des Kraftwerks auf seiner gesamten Länge von 3,2 Kilometern mit Kunststoffdichtungsbahnen ausgekleidet. Auf diese Weise wird die Rauigkeit reduziert und der Abfluss im Kanal optimiert. Neben zahlreichen Sanierungs- und Modernisierungsarbeiten an Wehranlage und Maschinensatz ersetzte die Kelag die Fischaufstiegshilfe durch eine moderne Fischschnecke, mit der auch große Fische wie der Huchen die Wehranlage passieren können. Diese innovative Art des Fischaufstiegs hat den zusätzlichen Vorteil, dass die Fließenergie des Wassers für die Stromerzeugung genutzt werden kann. So werden pro Jahr zusätzlich rund 500.000 Kilowattstunden Strom erzeugt.
Die Wehranlage und die Kraftwerke Schütt 1 und Schütt 2 liegen inmitten eines Natura 2000-Gebiets in der Marktgemeinde Arnoldstein. Die Sanierungsarbeiten wurden deshalb von einer ökologischen Bauaufsicht begleitet. Dabei wurden 2.100 Laubbäume gepflanzt und gezielte Maßnahmen für den Erhalt der stark gefährdeten Orchideenart Moor-Glanzständel (Liparis loeselii) gesetzt. In Zusammenarbeit mit der Arge NATURSCHUTZ wurden sämtliche Gehölze entfernt, die Brachflächen gemäht und so ein neuer Lebensraum für diese gefährdete Orchideenart geschaffen. Außerdem wurden Amphibienschutzmaßnahmen am Oberwasserkanal umgesetzt und ein Laichtümpel für die in Kärnten vom Aussterben bedrohte Libellenart Große Moosjungfer (Leucorrhinia pectoralis) geschaffen.
Das Schau-Kraftwerk Forstsee
Das Kraftwerk Forstsee wurde 1925 als erstes Speicherkraftwerk Kärntens in Betrieb genommen. Errichtet wurde das Krafthaus am Ufer des Wörthersees nach den Plänen von Franz Baumgartner, dem bedeutendsten Vertreter der Wörthersee-Architektur. Der Maschinensatz hat eine Leistung von 2,4 Megawatt und erzeugt rund 3 Millionen Kilowattstunden Strom pro Jahr.
Geplant und errichtet wurde das Kraftwerk Forstsee in den 1920er-Jahren, um die Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee zuverlässig mit Energie aus Wasserkraft zu versorgen. Zur Stromerzeugung wird das Wasser des rund 160 Meter höher gelegenen Forstsees über Druckrohrleitungen zum Krafthaus mit Pelton-Zwillings-Turbine, Generator und Schaltanlage geleitet. Seit 1967 befindet sich westlich des Krafthauses ein 110-kV-Umspannwerk der Kärnten Netz. Der Forstsee mit einem Speicherinhalt von rund 4,7 Millionen Kubikmetern Wasser ist aufgrund seiner idyllischen Lage ein beliebtes Naherholungs- und Badegebiet. Die Kelag investierte in den vergangenen Jahren rund 4 Millionen Euro in die Sanierung des Kraftwerks Forstsee. Die Effizienzsteigerung bestehender Kraftwerke ist ein wesentlicher Beitrag zum Klimaschutz und zur nachhaltigen Stromversorgung mit Wasserkraft. Der See und seine Uferzonen sind im Eigentum der Kelag und frei zugänglich.
Unter dem Motto „Kunst im Kraftwerk“ stellt die Kelag die Räumlichkeiten des Schau-Kraftwerks jedes Jahr renommierten Künstlern für Ausstellungen zur Verfügung und bietet ihnen damit eine Plattform, um sich und ihre Arbeiten der Öffentlichkeit zu präsentieren. Die starke Verbundenheit des Unternehmens mit dem Thema Kunst stellt auch die Nordseite der Maschinenhalle unter Beweis. Dort ist die beeindruckende Emailwand „Die Verdrängung des Stieres und des Hirten durch die Maschine“ von Giselbert Hoke zu bestaunen. Schautafeln im frei zugänglichen Teil des Krafthauses bieten außerdem Informationen zu Kraftwerk und Künstlern und ein Gastronomiebetrieb bewirtet die Besucher am Ufer des Wörthersees.
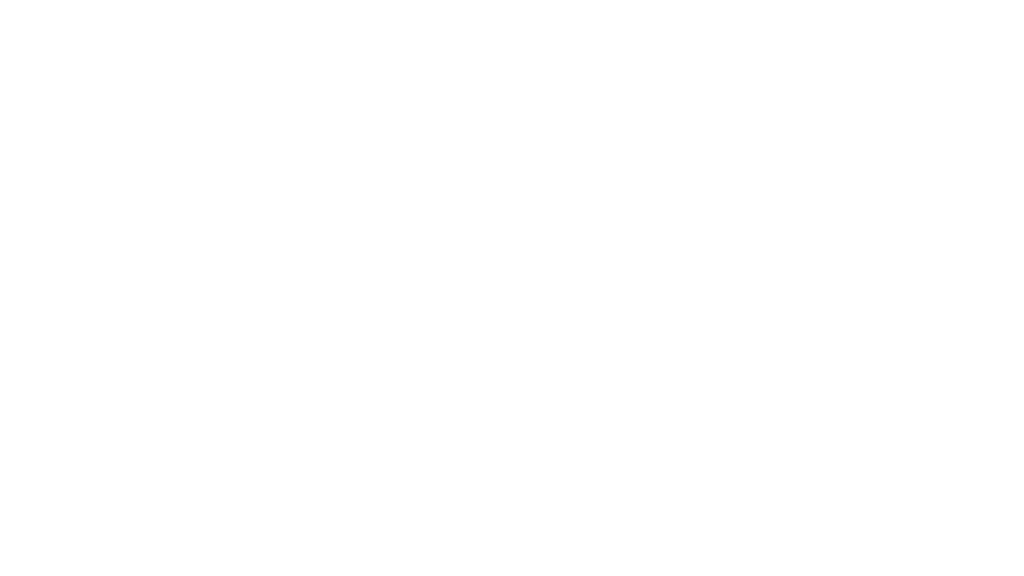
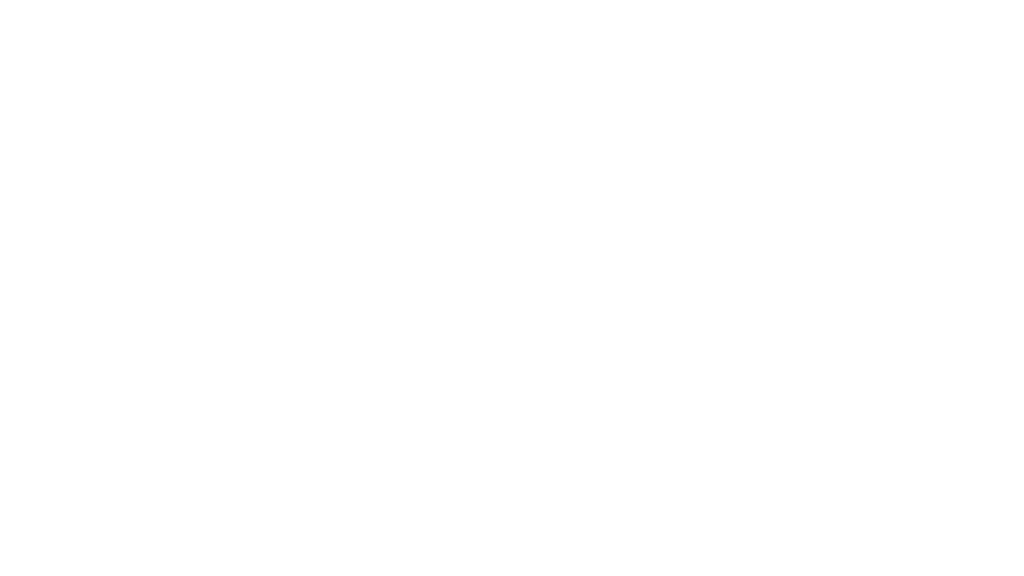
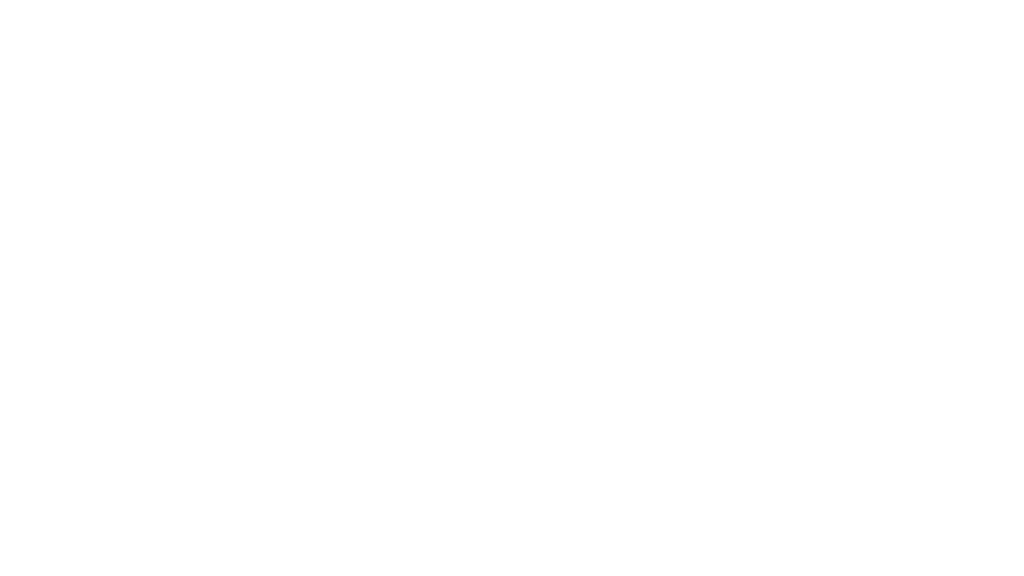
Karriere bei der Kelag
Als modernes Unternehmen liegt soziale Verantwortung gegenüber Arbeitnehmern in unserer Natur. Gemeinsam mit der Kelag haben auch Sie die Möglichkeit, schon heute die Welt von morgen aktiv mitzugestalten.
Presse
In unserem Kelag-Presseportal finden Sie aktuelle Meldungen und die Möglichkeit zur Anmeldung zu unserem Presseverteiler. Ihre Ansprechpartner des Kelag-Presseteams beantworten gerne Ihre Fragen.